Vettweiß: Es sei zwar nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“ – doch der 35-jährige Michael Schönen aus Kelz hat sich als einer der ersten Landwirte in der Zülpicher Börde dazu bereit erklärt, Wegraine entlang seiner Felder erst Mitte Mai zu mulchen, später im Jahr als üblich. Auch wird er nahe des Rains, der der Gemeinde Vettweiß gehört, auf Dünger und Spritzmittel verzichten. Schönen und andere Landwirte nehmen damit am Projekt „Wegrainmanagement / Blütenreiche Säume für die Artenvielfalt“ der Biologischen Stationen Düren, Bonn/Rhein-Erft und Euskirchen in der Zülpicher Börde teil. Ziel dieses dreijährigen Projektes ist es, Wegsäume in den Gemeinden Vettweiß, Titz, Zülpich und Erftstadt ökologisch wieder aufzuwerten und damit Pflanzen und Tieren neuen vielfältigen Lebensraum zu bieten.
Allein in diesem Jahr sollen es 3.000 Quadratmeter in den Gemeinden Vettweiß und Titz sein. Artenreiche Wegraine bieten Nahrung in Form von Pollen, Nektar oder auch Samen. Zugleich ermöglichen sie Hase und Rebhuhn Deckung, Vögeln, Insekten, Reptilien und Säugern Nist- bzw. Überwinterungsplatz.

Die Wildkräutermischung besteht aus 16 regionaltypischen Arten. [Foto: js]
Neben Regen sind vor allem zwei Dinge wichtig, damit das Projekt gelingen kann: Die Gemeinden, denen die Wegraine gehören, müssen dem Projekt zustimmen. (Hierzu geben die Biologischen Stationen unter anderem parzellengenaue konkrete Handlungsempfehlungen und stellen zerstörte Wegraine wieder her, alles kostenfrei.) Die Landwirte müssen bei der Naturpflege mitmachen, mit den Biologischen Stationen zusammenarbeiten. Denn die beste Saat nütze nichts, wenn die Pflanzen vor der Blüte abgemäht oder durch Spritzmittel absterben würden, so Düssel-Siebert.
Landwirt Schönen steht dem Naturschutz offen gegenüber. Er „taste sich langsam heran“, wie er selbst sagt. Vor gut einem Jahr hat der Landwirt Kontakt mit Alexandra Schieweling und Joyce Janssen von der Biologischen Station Düren aufgenommen, nachdem er ein Kiebitznest mit Eiern auf einem seiner Felder entdeckt hatte. Die beiden schützten daraufhin das Nest. Auf einer seiner Flächen mache er inzwischen auch Vertragsnaturschutz, sagt Joyce Janssen. Landwirte bewirtschaften ihre Flächen naturschonender und erhalten dafür Prämien. Eine Möglichkeit ist der so genannte Ernteverzicht. Das Getreide bleibt über Winter als Nahrung für die Vögel stehen.

Landwirt Michael Schönen im Gespräch mit der Leiterin der Biologischen Station Düren Heidrun Düssel-Siebert. [Foto: js]
Gern animiert er auch andere Landwirte, dem Schutz der Natur offener gegenüber zu stehen und beispielsweise nicht jedes Unkraut wegzuspritzen. Wer neugierig ist und sich das Ergebnis der Aussaat am Wegrain von Schönens Feldern einmal in den nächsten Monaten ansehen möchte, folgt hinter der Ortschaft Vettweiß-Kelz in Richtung Isweiler einem Hinweis- und Informationsschild, das die Biologische Station Düren in den nächsten Tagen dort anbringen wird.
Tipps zum ökologischen Landbau gibt es unter http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/oekolandbau/
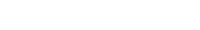

Bisher 1 Kommentar
Kommentar schreiben
Wunderschöne Aktion! Mehr davon! Überall!
Und kleinteilige, extensive Landwirtschaft würd‘ auch helfen.
—
Beim Lesen ist mir aber eine Frage gekommen…
112.000 Euro um Wildblumen auf 3.000 m2 zu säen? Das ist sportlich.
37,33 Euro pro Quadratmeter.
Kaufen die die Flächen?
Oder geht das Budget für’s Flowerconsulting beim „Wegrainmanagement“ drauf?
Fragen über Fragen…
Einen neuen Kommentar schreiben
Um einen neuen Komentar zu schreiben, melden Sie sich bitte mit ihrem Benutzernamen und Passwort an. Wenn Sie noch keinen EIFELON-Account haben, können Sie sich kostenlos und unverbindlich registrieren.